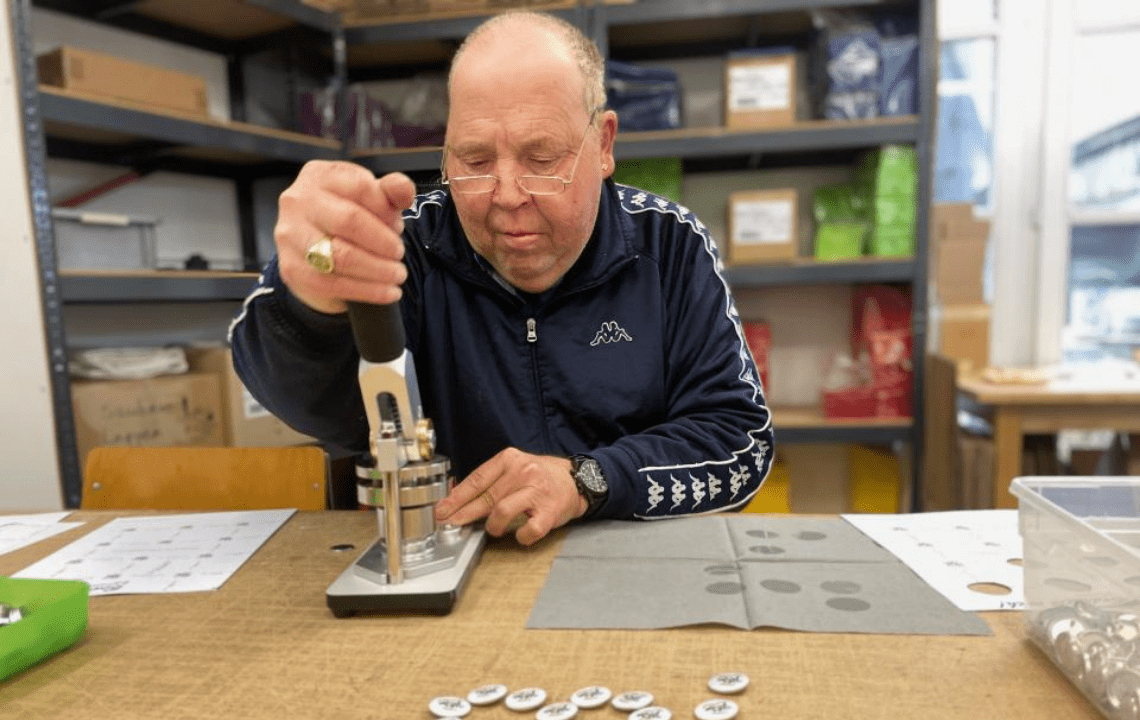· Lesedauer: 4 Min. · 0 Kommentare
Artikel teilen
«Mein Sohn sitzt seit Jahren im Gefängnis. Das Gericht verurteilte ihn wegen vorsätzlicher Tötung. Er soll zwei Männer mit einem Messer niedergestochen haben. Er war damals knapp 18. Ich bin zutiefst überzeugt, dass er unschuldig ist. Denn er sagt bis heute, er habe dem Täter das Messer entrissen, aber nicht selbst zugestochen. Ich bewundere ihn dafür, dass er die Hoffnung nie aufgibt, dass dieser Albtraum eines Tages vorbei ist. Seit jener Nacht, als mein Sohn festgenommen wurde, bin ich wie zweigeteilt.
Ich führte ein Leben inkognito
Meine Mutter und meine Tochter erwarten von mir, dass ich Kraft habe, alles durchzustehen. In der Öffentlichkeit vermeide ich es, erkannt zu werden. Aber zur Arbeit muss ich trotzdem und dort muss ich funktionieren. Dabei hatte ich damals, als der Albtraum begann, gerade meine Arbeitsstelle verloren und musste eine neue finden. All das habe ich geschafft. Ich konnte die Fassade aufrechterhalten – und kann es auch heute noch. Aber es kostet mich viel Kraft. Mit einer Arbeitskollegin kann ich zum Glück offen darüber reden, wie es mir geht. Das hilft mir im Berufsalltag. Der andere Teil meiner Persönlichkeit war vor allem in der ersten Zeit von Verzweiflung beherrscht.
Sie nannten mich «Mördermutter»
Inzwischen hat diese Verzweiflung einer tiefen Traurigkeit Platz gemacht. Bis heute schlafe ich pro Nacht nur zwei bis drei Stunden. Ich kann ohne Medikamente nicht mehr leben. Bis vor kurzem haben mir Angehörige der Opfer immer wieder «Mördermutter» nachgeschrien. So viel Hass, dabei habe ich doch nichts getan. Lange habe ich die Schuld für das, was passiert ist, bei mir gesucht. Das hat mich fast in den Suizid getrieben. Jetzt kann ich mich gegen solche Anklagen abgrenzen. Ich habe sogar wieder gelernt zu lachen. Trotzdem wollte ich nie in eine andere Stadt ziehen. Hier habe ich meine Freunde. Es sind nicht viele, aber gute, die wirklich zu mir halten. Geholfen hat mir auch die Heilsarmee, die sich vor allem um meinen Sohn kümmerte.
Die Heilsarmee im Gefängnis
Im Gefängnis lernte mein Sohn Hedy Brenner von der Heilsarmee kennen. Im Rahmen ihres Dienstes besucht sie regelmässig Inhaftierte. Ich war erleichtert, dass mein Sohn ihr alles anvertrauen konnte und sie seine Sorgen ernst nahm. Sie erzählte ihm auch vom Heilsarmee-Fahrdienst, der Angehörige auf den Thorberg bringt. Das Berner Gefängnis liegt abseits des Bahnhofs auf einem Hügel. Dieser war für mich immer nur schwer zu erreichen. Ich habe selbst kein Auto und bin nach mehreren Knieoperationen körperlich eingeschränkt. Der Fahrdienst war ein Segen für mich. Während der Fahrten hatte ich auch einmal Zeit, mit jemandem über alles zu reden. Das hat mir unglaublich gut getan.»
Quelle: Heilsarmee, Daniela Deck
(Gesundheitstipp Dezember 2013)
«Mit der Heilsarmee zu sprechen tat mir unglaublich gut.»
Wie geht es Ihnen heute?
Es geht mir besser als damals. Aber trotzdem leide ich immer noch sehr als Mutter meines inhaftierten Sohnes. Es strengt mich manchmal auch an, immer die Wochenenden für Besuche in einer Strafanstalt zu reservieren.
Was beschäftigt Sie?
Mich beschäftigt sehr, dass Angehörige mitverurteilt werden und sich meistens nicht zu wehren wissen. Hier versuche ich zu helfen, wenn ich kann. Die meisten Angehörigen schweigen und schämen sich, deshalb melden sie sich nicht.
Wie geht es Ihrem Sohn?
Im Moment besser. Er ist nach langer Zeit in einer etwas menschlicheren Strafanstalt gelandet. Aber der Zustand immer noch eingesperrt zu sein, zehrt an ihm und auch an seiner Schwester. Wir hoffen, dass er bald einen Ausgang zugesprochen bekommt und wir ihn einmal ausserhalb der Mauern sehen können.